Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt
Den Herausforderungen die Stirn bieten
Das Jahr 2024 war von schweren Ereignissen geprägt, die uns vor grosse Herausforderungen stellten und zeigten, dass wir in der Lage sind, diese zu bewältigen. Unsere Belastbarkeit und unsere Solidarität wurden auf die Probe gestellt.
Zu Beginn des Sommers waren nach Hochwassern und Murgängen ein Todesopfer in Saas-Grund und eine vermisste Person in Binn zu beklagen. Im Abschnitt Siders-Chippis führte eine Überschwemmung der Rhone zur Evakuierung von über 200 Personen und brachte den Industriebetrieb zum Erliegen. Die Überarbeitung der 3. Rhonekorrektion und ihres Generellen Projekts (GP-R3), die vom Staatsrat im Mai 2024 verabschiedet wurde, sollte die Blockaden aufheben und somit eine Beschleunigung der Arbeiten ermöglichen.
Die Naturereignisse haben auch unsere in die Jahre gekommene und infolge Verkehrswachstum ohnehin schon geschwächte Strasseninfrastruktur stark in Mitleidenschaft gezogen. Da die Erdrutsche und Murgänge sich häufen und unvorhersehbar sind, braucht es innovative bauliche Massnahmen, die mit den vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen machbar sind, aber auch strategische Entscheide bezüglich des Unterhalts des Strassennetzes. Ein gutes Beispiel dafür war der Einsturz des La Becque-Tunnels am 4. Februar 2024 und dessen anschliessender Wiederaufbau innerhalb von vier Monaten.
Auch der Bau der A9 im Oberwallis ist dem unberechenbaren Klima ausgesetzt. Heftige und wiederkehrende Regenfälle haben die Hangbewegungen um den Riedbergtunnel beschleunigt, was den Bau eines Entwässerungsstollens erforderlich machte und die Inbetriebnahme des Bauwerks um ein Jahr verzögert.
Die Raumplanung, mit der Revision der Zonennutzungspläne (ZNP) und der kommunalen Bau- und Zonenreglemente (KBZR), stellt einen weiteren Schwerpunkt dar. Allerdings stellt die Grösse der Aufgabe ein grosse Herausforderung dar, um die vom Bund vorgegebenen Fristen einzuhalten.
Schliesslich konnte durch den Abschluss einer Vereinbarung über die Finanzierung des Baus einer Dichtwand ein wichtiger Meilenstein bei der Sanierung der ehemaligen Deponie Gamsenried erreicht werden.
Ich danke an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Departements für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU) für ihren tagtäglichen Einsatz, mit welchem in zahlreichen Dossiers Fortschritte erzielt werden konnten, obwohl beträchtliche Ressourcen zur Bewältigung der Unwettersituation mobilisiert werden mussten.
Franz Ruppen
Staatsrat

Mobilität 2040
Die Umsetzung der kantonalen Mobilitätsstrategie 2040 wurde fortgeführt, unter anderem durch die voranschreitende Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Vétroz.
Zusammen mit den Gemeinden wurde intensiv an der Instandsetzung des Kantonsstrassennetzes und am Planungsbeginn zur Integration des Alltagslangsamverkehrs in die kantonalen Infrastrukturen gearbeitet.
Das neue Strassengesetz wird am 1. Januar 2025 in Kraft treten.

Kantonsstrassen
Eine der vielen Herausforderungen bleibt auch 2024 wieder der Zustand des Kantonsstrassennetzes in einem alpinen Umfeld, das hohe Anforderungen an die Infrastruktur stellt. Um dieser Herausforderung zu begegnen, überarbeitet die Dienststelle für Mobilität (DFM) ihre Unterhaltspolitik von Grund auf. Zunehmende Belastungen (Anzahl Fahrzeuge, Tonnagen, Naturgefahren), verbunden mit sich immer weiter entwickelnden normativen Anforderungen (Sicherheit, Umwelt etc.), wirken auf ein weitläufiges Strassennetz ein, das hauptsächlich in den 1960er und 1970er Jahren gebaut wurde und sich dem Ende seines Lebenszyklus nähert. Diese Tatsache wurde durch den Einsturz des La Becque-Tunnels zwischen Riddes und Isérables am 3. Februar 2024 verdeutlicht. Dank der Aktivierung der allgemeinen Polizeiklausel durch den Staatsrat konnte der Tunnel in einer Zeitspanne von unter vier Monaten wiederhergestellt werden. Dies zeigt, warum die für die Substanzerhaltung des Kantonsstrassennetzes erforderlichen Personal- und Finanzressourcen beträchtlich sind.
Zwischen Ende Juni und Anfang Juli 2024 kam es zu einer schweren Unwetterperiode, in welcher grosser Schaden an der kantonalen Infrastruktur entstand. Die Summe der Schäden an der kantonalen Mobilitätsinfrastruktur belief sich auf rund 42 Millionen Franken.
Über 50 solcher Projekte befinden sich heute in unterschiedlichen Stadien der Planung und Entwicklung. Die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Stalden wurde 2024 öffentlich aufgelegt, und die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt von Vétroz werden noch bis 2026 dauern. Noch weitere Projekte wurden 2024 öffentlich aufgelegt, etwa die Erneuerung der Kantonsstrasse zwischen Pont-de-la-Morge und Sitten, der südlichen Ortsdurchfahrt von Muraz oder der Durchfahrt der Ortschaften Roumaz und St-Germain in Savièse. Die Durchfahrt von Turtmann, die Erneuerung der Ortsdurchfahrten von La Fouly und Saxon sowie der Avenue de Tourbillon in Sitten sind derzeit in Planung und werden 2025 zur öffentlichen Auflage gelangen.
Die DFM war im Jahr 2024 für die folgenden Grossbaustellen verantwortlich:
Unterwallis
- Fortführung der Bauarbeiten am Tunnel Les Evouettes,
- Fortführung der Fahrbahnrestrukturierung in Troistorrents, auf der Strasse Monthey – Morgins, Abschnitt Chapelle St-André – Kehre Es-Cortaz,
- Fahrbahnrestrukturierung und Trottoirbau innerorts von Bruson,
- Verstärkung der Mauern und Fahrbahnrestrukturierung vor der Kehre bei der ARA in Verbier,
- Fahrbahnrestrukturierung und Trottoirbau zwischen Savoleyre und Nifortsié in Verbier,
- Fahrbahnrestrukturierung und Trottoirbau auf der Route des Caves in Riddes,
- Verstärkung und Verbreiterung bei Les Afforets zwischen Leytron und Ovronnaz,
- Sanierung der Brücke «Pont des Availles» in Finhaut,
- Sanierung des La Becque-Tunnels zwischen Riddes und La Tzoumaz nach dem Einsturz im Februar,
- Wiederherstellung eines Zugangs zum Haut Val de Bagnes nach den Unwettern vom Juli.
Mittelwallis
- Fortführung der Bauarbeiten an der Erneuerung der Ortsdurchfahrt von Vétroz,
- Abschluss der Umbauarbeiten an den Kreuzungen bei Pont-de-la-Morge,
- Einrichtung eines Zweirichtungsvelowegs zwischen Regrouillon und der Kreuzung mit der Rue de la Fraternité in Noës,
- Beginn des Umbaus der Kreuzung Etoile in einen Kreisverkehr in Montana,
- Beginn der Fahrbahnkorrektion und des Trottoirbaus am Ortseingang von Hérémence,
- Beginn der Fahrbahnkorrektion auf der Route de la Morge in Plan-Conthey.
Oberwallis
- Abschluss der Erneuerung des Ortszentrums von Bitsch,
- Bau der Bildjikehr-Brücke als Ersatz für eine Stützmauer, die ein Rutschrisiko für Inden darstellt, an der Strasse von Leuk nach Leukerbad,
- Fortführung der Bauarbeiten am Galerieprojekt Lüegelti und Schusslaui kurz vor Zermatt,
- Fertigstellung des Ausbaus der Strasse St. Niklaus – Grächen,
- Sanierung diverser Fussgängerübergänge,
- Sofortmassnahmen nach den Unwettern im Juli und September im Goms, Saasertal und Mattertal.
Alle im kantonalen Winterdienst eingesetzten Maschinen werden durch ein GPS-System überwacht. Mit dieser Lösung konnte die Verwendung der über 12’400 Tonnen Streusalz, die 2024 gebraucht wurden, optimiert werden.

Öffentlicher Verkehr und Langsamverkehr
Zahlreiche Buslinien im ganzen Kanton profitierten von einer Verbesserung ihres Angebots. Bei der Bahn wurden zwischen dem Wallis und Bern neue Verbindungen am frühen Morgen und am späten Abend eingeführt. Das Angebot des RER Valais/Wallis an Samstagen wurde ausgebaut, mit Zügen zwischen Brig und Monthey im Halbstundentakt.
Die DFM führt die Analyse der Linien des regionalen Personenverkehrs mit anhaltend interessantem Potenzial fort, um das Leistungsangebot weiterzuentwickeln. Die von 2019 bis 2023 um 13 % angestiegenen Fahrgastzahlen auf den Regionallinien beweisen, dass der öffentliche Verkehr für die Walliser Bevölkerung attraktiv ist.
Der «Pass 13*» ist in seine zweite Testphase eingetreten. Danach wird man sich überlegen, ob er definitiv eingeführt und in das Sortiment nationaler Fahrausweise aufgenommen werden soll.
Im Jahr 2024 wurden die folgenden touristischen Seilbahnen in Betrieb genommen:
- Gondelbahn Les Marécottes – La Creusaz,
- Kombibahn Prarion – Tracouet.
Sieben Projekte für Verbindungen zwischen Talebene und Gebirge wurden beim Bundesamt für Verkehr (BAV) zur Prüfung und Aufnahme in den nächsten STEP-Ausbauschritt eingereicht.
Nach den Murgängen vom Juli in Sarreyer wurde die Einrichtung einer kleinen, temporären Seilbahn (acht Plätze) zur Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs beschlossen. Sie soll ihren Betrieb im Februar 2025 aufnehmen und schrittweise automatisiert werden. Die Anlage wird so lange betrieben, bis die weggespülte Brücke wiederaufgebaut ist.
Der vom Bundesamt für Verkehr (BAV) geforderte Auslagerungsprozess der vom Staat im Auftrag der Gemeinden geführten Seilbahnen wurde Ende 2024 abgeschlossen.
Das wichtigste Ereignis war 2024 die Verabschiedung der kantonalen Strategie «Langsamverkehr 2040» durch den Staatsrat. Diese Strategie zeigt eine Vision für die Entwicklungen, die notwendig sind, um den Fuss- und Veloverkehr im Alltag und in der Freizeit zu fördern. Nachdem die diesbezüglichen eidgenössischen und kantonalen Gesetzesgrundlagen 2023 in Kraft getreten waren, vervollständigte der Kanton so sein Instrumentarium, damit er seine Aufgaben erfüllen, sich künftigen Herausforderungen stellen und diese Verkehrsarten fördern kann.
Diese neue Strategie beruht auf drei Grundpfeilern: der Planung der Netze, der Erstellung der Infrastruktur und der Durchführung von Fördermassnahmen. Die Studien zu Sachplänen für den Alltagsveloverkehr wurden auf dem ganzen Kantonsgebiet fortgesetzt. Sie werden gemeinsam mit den Standortgemeinden durchgeführt und zielen darauf ab, die zu entwickelnden Netze oder anzupassenden Infrastrukturen zu bestimmen. Die laufenden Erneuerungsarbeiten an den Kantonsstrassen boten die Gelegenheit, erste verkehrsgetrennte Veloverkehrsanlagen zu realisieren.
Abschliessend zu erwähnen wären noch die aktive Teilnahme an der Europäischen Mobilitätswoche und die Durchführung eines partizipativen Workshops zur Förderung des Alltagslangsamverkehrs im Wallis.

Bau der A9 im Oberwallis
Das Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (GS-UVEK) hat die Plangenehmigung für das Ausführungsprojekt am 26. März 2021 erteilt. Daraufhin gingen verschiedene Beschwerden ein. Seit dem 19. November 2024 liegt nun das Urteil des Bundesgerichts vor: mit dem Bau des Autobahnabschnittes durch den Pfynwald kann im kommenden Jahr begonnen werden. Die Detailplanungen laufen parallel, und die Ausschreibungen der Vorarbeiten für die Realisierung des Ausbaus der beiden Kreisel in Siders Ost wurden bereits Mitte Dezember 2024 publiziert.
Das Bundesgericht hat den Bau der geplanten Passerelle über die Rhone abgelehnt und das Bundesamt für Strassen (ASTRA) aufgefordert, die Detailplanung des Gesamtschutzkonzepts ohne dieses Bauwerk an die Hand zu nehmen.
Die erste Etappe der archäologischen Grabungen auf der Fläche des künftigen Materialzwischenlagers Pfyngut Süd wurde erfolgreich abgeschlossen.
Die Sohle und das Gewölbe der beiden Röhren des Tunnels Riedberg sind zu 85 % betoniert. Die Extremniederschläge und die ungewöhnlich grossen Wassermassen, die in den Boden und den Untergrund einsickerten, haben die Hangbewegungen beschleunigt und die Stabilität des Tunnels und der umliegenden Infrastruktur kritisch beeinträchtigt. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat der Staatsrat die allgemeine Polizeiklausel aktiviert, um – in Absprache mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) – einen Stollen zu bauen, mit dem die Fliesswege des Wassers erkundet, der Hang entwässert und so die Verformung des Tunnels verringert werden kann. Der 1,5 Kilometer lange Stollen wird über dem Riedbergtunnel auf dem Gebiet der Gemeinden Niedergesteln, Turtmann-Unterems und Steg-Hohtenn gegraben. Die Arbeiten werden zwei Jahre dauern. Mit dieser aktiven Hangdrainage können die Bewegungen des Hangs wieder auf ihre normale Geschwindigkeit reduziert werden. Damit verzögert sich die Inbetriebnahme des Tunnels Riedberg um ein Jahr auf 2027.
Der Vollanschluss Raron ist fertiggestellt. Die betriebs- und sicherheitstechnische Ausrüstung des Gedeckten Einschnitts Raron (GERA) ist zu 70 % abgeschlossen. Die offene Autobahnstrecke zwischen GERA und Visp West ist bis auf die Rückhaltesysteme und Markierungen fertiggestellt.
Das GS-UVEK hat am 9. Juni 2023 die Plangenehmigung für den Lastwagenstauraum und die Stellplätze Steineja erteilt. Vor Bundesverwaltungsgericht sind 2 Rekurse hängig.
Am 3. Juli 2024 fand die Startsitzung für die Inbetriebnahme des Tunnels Visp und des Überwurftunnels statt. An solchen Sitzungen nehmen Mitarbeitende des ASTRA (Netzvollendung und Filiale Thun), der Dienststelle für Mobilität, der Gebietseinheit III, der Kantonspolizei, des kantonalen Amts für Feuerwesen, der Sanität Oberwallis und der DNSB teil. Ziel ist es, die verschiedenen Objekte der Südumfahrung im Jahr 2025 dem ASTRA zu übergeben.

Gebietseinheit III
Zwei schwere Ereignisse standen 2024 im Vordergrund. Zunächst erkannte die GE III die Gefahr eines Felssturzes oberhalb der Galerie Engi auf der A9 am Simplon. Daraufhin wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) ein Überwachungsgerät angebracht, dank dem die Strasse vor dem Murgang vom 29. Juni (10'000-12'000 m3) gesperrt werden konnte. Die Strasse wurde innerhalb einer Woche wieder geöffnet, und es wurde ein Überwachungs- und Alarmsystem für die Früherkennung von Steinschlägen und Murgängen eingebaut. Am nächsten Tag wurden die Autobahn sowie der Werkhof in Siders während des Rhone-Hochwassers überschwemmt. Auch hier standen die Teams im Einsatz, um die Anlagen so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen.
In bauleitender Funktion liess die GE III zahlreiche Reparaturen an Bauwerken für einen Betrag von über 10 Millionen Franken ausführen.
Wegen Lawinengefahr auf der italienischen Seite des Simplonpasses war die Strasse vom 30. März bis 3. April gesperrt, was beim Rückreiseverkehr nach dem Osterwochenende zu erheblichen Problemen führte. Das ASTRA und die GE III tragen grosse Sorge zur Strassenverfügbarkeit, doch manchen Unvorhersehbarkeiten gegenüber sind sie machtlos.
Die GE III bereitet sich auf organisatorischer Ebene darauf vor, den Abschnitt Raron – Visp im Laufe des Jahres 2025 zu übernehmen. Da ein grosser Teil der Strecke gedeckt verläuft, ist die Übernahme des Abschnitts eine Herausforderung.
Um neue Sicherheitsstandards zu erfüllen, müssen unsere Mitarbeiter immer mehr Schulungen absolvieren, was eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt.

Recht und Gesetz
Die Vorentwürfe für die Revision des Baugesetzes (BauG) und der Bauverordnung (BauV) waren vom 1. Dezember 2023 bis 8. Februar 2024 in der Vernehmlassung. Der Entwurf für die Totalrevision des Baugesetzes (BauG) wurde vom Grossen Rat in der Septembersession 2024 in erster Lesung mit 121 zu 1 Stimmen angenommen. Die zweite Lesung des Entwurfs ist für die Februarsession 2025 vorgesehen.
Ein dringliches Dekret zur Änderung des Baugesetzes wurde vom Grossen Rat in der Dezembersession 2024 einstimmig und in einer einzigen Lesung verabschiedet. Dieses Dekret trat am 31. Dezember 2024 in Kraft, um die Frist für die Anpassung der kommunalen Bau- und Zonenreglemente (KBZR) bis zum Inkrafttreten des künftigen revidierten Baugesetzes zu verlängern.
Die Totalrevision der Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über die Naturgefahren und den Wasserbau (VNGWB) trat am 17. Juli 2024 in Kraft.
Der Verwaltungs- und Rechtsdienst des DMRU (VRDMRU) hat einen Vorschlag für ein Gesetz über die Georessourcen ausgearbeitet. Dieser wird der Arbeitsgruppe, die neu mit der Ausarbeitung des Vorentwurfs für das Gesetz beauftragt ist, als Grundlage dienen.
Unter der Leitung der Dienststelle für Umwelt wurde die Ausarbeitung des Vorentwurfs für die Revision des kantonalen Umweltschutzgesetzes (kUSG) fortgeführt.
An der Teilrevision des Reglements über die Gebühren für den Sondergebrauch des öffentlichen Eigentums auf kantonalen Verkehrswegen und am Genfersee wird ebenfalls weitergearbeitet.
Die Bereiche des öffentlichen Baurechts, der Zweitwohnungen und insbesondere der Raumplanung bedürfen nach wie vor erheblicher juristischer Ressourcen. Allein für die vollständige Revision der KBZR müssen zum Beispiel jeweils mehrere hundert, oft über tausend Seiten an Reglementen und Berichten geprüft werden. Die voranschreitende Implementierung des Programms eConstruction bedarf eines regelmässigen juristischen Engagements, und die Integration der neuen Gemeinden erfordert spezifische Schulungen. Auch die bevorstehende Einführung der zweiten Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG2) wird eine grosse Aufgabe darstellen. Dasselbe gilt für die Dossiers zur Entwicklung von Photovoltaik-Grossanlagen. Die Zahl der Fragen, die im Zusammenhang mit dem Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung zu behandeln sind, wächst rasant.
Am 31. Dezember 2024 war die Zahl der beim KBS registrierten neuen Baugesuche (3047) gegenüber 2023 um 132 Dossiers gesunken (kommunale und kantonale Zuständigkeit zusammengenommen). Bei der Baupolizei, Dossiers ausserhalb der Bauzone, wurden 131 neue Dossiers registriert.
|
Stand am 31.12.2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 | 2024 |
|
Ganzes KBS |
|
|
|
||
|
Registrierte Dossiers insgesamt |
3378 |
4111 |
3719 |
3179 | 3047 |
|
Baudossiers in kantonaler Kompetenz |
1380 |
1376 |
1318 |
1201 | 1177 |
|
Baupolizeiliche Dossiers (kantonale Kompetenz) |
201 |
305 |
214 |
179 | 131 |
|
Dossiers in kommunaler Kompetenz |
1797 |
2430 |
2187 |
1799 | 1739 |
|
Kreis 1 - Oberwallis |
|
|
|
||
|
Registrierte Dossiers insgesamt |
868 |
1050 |
903 |
794 | 840 |
|
Baudossiers in kantonaler Kompetenz |
343 |
377 |
274 |
288 | 324 |
|
Baupolizeiliche Dossiers (kantonale Kompetenz) |
40 |
39 |
18 |
41 | 29 |
|
Dossiers in kommunaler Kompetenz |
484 |
634 |
611 |
465 | 487 |
|
Kreis 2 - Mittelwallis |
|
|
|
||
|
Registrierte Dossiers insgesamt |
1222 |
1415 |
1327 |
1115 | 1048 |
|
Baudossiers in kantonaler Kompetenz |
524 |
489 |
521 |
411 | 395 |
|
Baupolizeiliche Dossiers (kantonale Kompetenz) |
96 |
108 |
85 |
66 | 58 |
|
Dossiers in kommunaler Kompetenz |
602 |
818 |
721 |
638 | 595 |
|
Kreis 3 - Unterwallis |
|
|
|
||
|
Registrierte Dossiers insgesamt |
1288 |
1646 |
1489 |
1270 | 1159 |
|
Baudossiers in kantonaler Kompetenz |
512 |
510 |
523 |
502 | 458 |
|
Baupolizeiliche Dossiers (kantonale Kompetenz) |
65 |
158 |
111 |
72 | 44 |
|
Dossiers in kommunaler Kompetenz |
711 |
978 |
855 |
696 | 657 |
Das Programm eConstruction erfordert ein anhaltendes Engagement des KBS.
Die Plattform eConstruction begann mit der Implementierung in 31 neuen Gemeinden, wie gemäss Planung vorgesehen. Gleichzeitig startete die zweite Pilotphase mit drei weiteren Gemeinden, so dass die Zahl der Gemeinden, die die Plattform eConstruction nutzen, 2024 auf 43 angestiegen ist.
Die Planung für die Integration der übrigen für 2025 vorgesehenen Gemeinden wurde abgeschlossen, und die ersten Informationssitzungen fanden im November 2024 statt.
Der Produktionsbetrieb und der Benutzersupport der Plattform sind nun für beide Sprachregionen in Betrieb.
Im Jahr 2024 betrug die Zahl der neu beim KKSS eingereichten Strassensignalisations- und reklamedossiers 870 (-6,15 % gegenüber 2023). Die Signalisationsdossiers nahmen um 19 (-2,61 %) ab, die Strassenreklamedossiers um 38 Dossiers (-19 %).
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Kreis 1 – Oberwallis | |||||
| Signalisationsdossiers | 80 | 83 | 146 | 118 | 161 |
| Strassenreklamedossiers | 45 | 44 | 46 | 43 | 45 |
| Kreis 2 – Mittelwallis | |||||
| Signalisationsdossiers | 275 | 363 | 259 | 311 | 284 |
| Strassenreklamedossiers | 123 | 79 | 137 | 94 | 81 |
| Kreis 3 – Unterwallis | |||||
| Signalisationsdossiers | 264 | 292 | 249 | 298 | 263 |
| Strassenreklamedossiers | 87 | 60 | 74 | 63 | 36 |
| Jahrestotal | 874 | 921 | 911 | 927 | 870 |
| Jahrestotal Signalisationsdossiers | 619 | 738 | 654 | 727 | 708 |
| Jahrestotal Strassenreklamedossiers | 255 | 183 | 257 | 200 | 162 |
Bei den Dossiers für Baustellensignalisationen verzeichnete das SeKKSS im gleichen Zeitraum 4193 Gesuche, was einer Zunahme von 58 Dossiers (+1,40 %) gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Das SeKKSS hat die Behandlung der Dossiers im Bereich der Strassensignalisation, der Strassenreklamen und der Baustellensignalisation insbesondere über seine Plattform SICHAN sichergestellt.
Bei Strassenbauprojekten oder Genehmigungsverfahren für vertikale oder horizontale Verkehrssignale hat das Sekretariat mit der Bevölkerung, den Unternehmen sowie den verschiedenen kantonalen und kommunalen Behörden zusammengearbeitet und sie unterstützt. In denselben Bereichen nahm es auch eine Überwachungsaufgabe wahr.
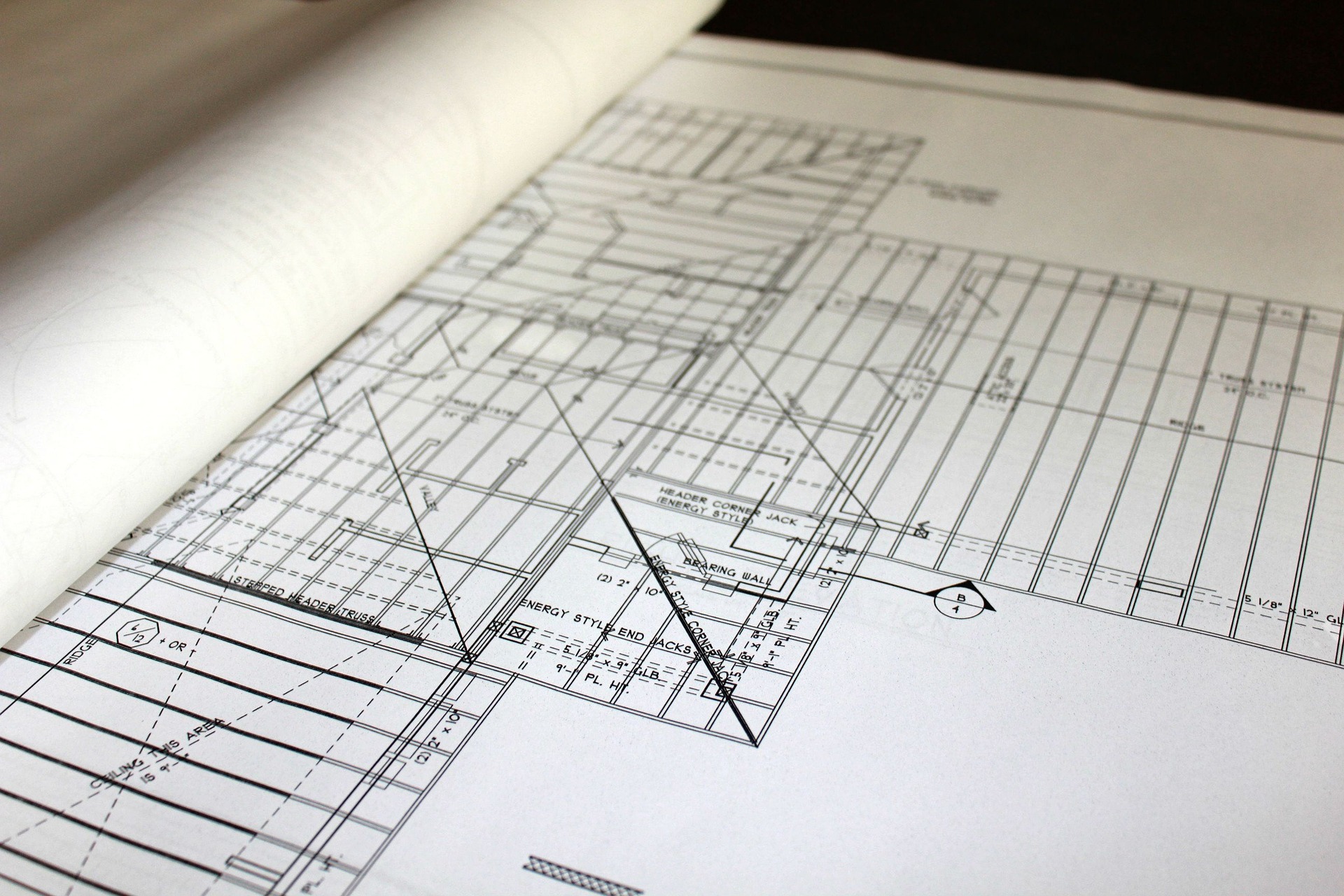
Naturgefahren
2024 war für die Dienststelle für Naturgefahren (DNAGE) ein besonders intensives Jahr.
Die heftigen Niederschläge Ende 2023 führten im Frühling 2024 zu geologischer Instabilität und so zu zahlreichen Schadenereignissen, etwa auf der Strasse nach La Tzoumaz, bei Les Condémines und auf der Hauptstrasse von Anniviers.
Im Mai 2024 beschloss der Staatsrat, eine Überarbeitung der 3. Rhonekorrektion und des dazugehörigen Generellen Projekts (GP-R3) einzuleiten. Ziel ist es, ein verhältnismässiges und realistisches Projekt vorzulegen, das ein hohes Sicherheitsniveau für Personen und Güter gewährleistet. Gleichzeitig wird die Realisierung mehrerer Massnahmen, die dringlich sind oder bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sich durch die Überarbeitung etwas an ihnen ändern wird, fortgesetzt.
Das Aufeinandertreffen einer verspäteten Schneeschmelze, gesättigter Böden und intensiver Niederschläge war die Ursache für zwei Hochwasser- und Murgangereignisse, die Ende Juni in Saas-Grund zu einem Todesopfer und in Binn zu einer vermissten Person führten. Besonders stark betroffen waren das Mattertal, das Val d’Anniviers und das Val d'Hérens. Im Abschnitt Siders-Chippis trat die Rhone über die Ufer, sodass über 200 Personen evakuiert werden mussten und die Industrie zum Erliegen kam.
Mehrere Murgänge ereigneten sich Anfang Juli im Wildbach Fregnoley. Sie verursachten grosse Schäden in der Region Lourtier (Val de Bagnes), machten zwei Kantonsstrassen unpassierbar und isolierten so das obere Val de Bagnes.

Raumentwicklung
Die Teilrevision von 12 Koordinationsblättern des kantonalen Richtplans (kRP) wurde im Februar 2024 ausgesetzt. Ende 2024 wurde der Prozess unter Hinzufügung weiterer Blätter und mit einem neuen Vernehmlassungsverfahren wiederaufgenommen.
Die kantonale Strategie für die Bewirtschaftung der Arbeitszonen sowie die Blätter A.5a «Zonen für landschaftsprägende Bauten» und A.5b «Weilerzonen» sind in Arbeit.
Im Rahmen der Umsetzung des RPG, des kRPG und des kRP setzte die Dienststelle für Raumentwicklung (DRE) ihre Unterstützung der Gemeinden bei der Durchführung der Gesamtrevision ihrer Zonennutzungspläne (ZNP) und kommunalen Bau- und Zonenreglemente (KBZR) fort. Zu diesem Zweck aktualisiert die DRE in Zusammenarbeit mit den beteiligten kantonalen Stellen die Arbeitshilfen und die Musterartikel für das KBZR. Ausserdem hat sie Merkblätter erstellt, welche die Anforderungen an die kommunale Planung präzisieren sollen.
Seit Ende 2024 verfügen vier Gemeinden über einen ZNP und ein KBZR, die vom Staatsrat genehmigt sind und sowohl dem RPG als auch dem Blatt C.1 «Dimensionierung der Bauzonen für die Wohnnutzung» des kRP entsprechen. Für die ZNP und KBRZ von fünf weiteren Gemeinden ist das Genehmigungsverfahren des Staatsrats noch in Gang. Zwei andere Gemeinden müssen infolge von Gerichtsentscheiden mit der Gesamtrevision ihres ZNP und KBRZ neu beginnen.
Schliesslich erhielt die DRE von 28 Gemeinden einen Entwurf für die Gesamtrevision ihrer ZNP und KBRZ und gab zu 21 davon eine Vormeinung im Stadium der Vorprüfung oder der Genehmigung ab. Gleichzeitig erhielt die DRE 15 Dossiers für ZNP-/KBZR-Teilrevisionen sowie für Sondernutzungspläne (SNP) und gab dazu 23 Vormeinungen ab.
Im Mai 2024 wurde das Mandat zur Ausarbeitung des Aktionsplans Landschaft 2026-2032 vergeben. Nach einer ersten Konsolidierungsphase mit den kantonalen Dienststellen werden die Gemeinden im Frühjahr 2025 zu einer Teilnahme an Workshops eingeladen.
Das Mandat für das erste Modellvorhaben Landschaft wurde abgeschlossen. Damit liegt nun ein Massnahmenkatalog für die Behandlung der Ränder zwischen Rebberglandschaft und bebauter Landschaft vor. Zwei weitere Modellvorhaben sind in Arbeit. Die Website des kantonalen Landschaftskonzepts befindet sich im Aufbau.

Umwelt
Mehrere Abwasserreinigungsanlagen (ARA) und/oder Kanalisationen wurden durch die Unwetter im Sommer beschädigt. Unter dem Einsatz von Betreibern, Behörden, Feuerwehr und freiwilligen Helfern konnte der Anschluss zu fast 90 % wiederhergestellt werden. Die meisten der stark beschädigten Anlagen waren im Dezember wieder betriebsbereit. In Siders-Noës, wo die Schäden besonders gross waren, wird es noch mehrere Monate dauern, bis die Abwasserreinigung wieder vollständig funktioniert.
Im August legte sich der Kanton einen kantonalen Bewirtschaftungsplan für Deponien und Anlagen zur Verwertung mineralischer Abfälle (BPDM) zurecht, um den zahlreichen wirtschaftlichen, rechtlichen und ökologischen Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen. Der BPDM nimmt eine Bestandsaufnahme der bestehenden Infrastrukturen und des Bedarfs vor. Er legt die wichtigsten Grundsätze für die Bewirtschaftung und die Planung für die nächsten Jahre fest. Der BPDM ergänzt den im August 2023 in Kraft getretenen kantonalen Abfallbewirtschaftungsplan, der auf den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft beruht.
Im Dezember unterzeichneten die Lonza AG, der Kanton Wallis, der Bund und die Gemeinde Brig-Glis eine Vereinbarung über die Finanzierung des Baus einer Dichtwand. Diese soll die bestehende hydraulische Sicherung verstärken und den Deponiebereich vom restlichen Grundwasserleiter des Rhonetals trennen. Die Lonza AG wird alle mit dem Bau dieser Wand verbundenen Kosten tragen. Die Ausgaben für die Verkehrsanpassungen während der Bauarbeiten übernehmen Bund und Kanton. Diese Vereinbarung, bzw. der damit beschlossene zügige Bau der Dichtwand, ebnet den Weg für eine dauerhafte Sanierung des Standortes.

Wald, Natur und Landschaft
Mit einer beträchtlichen Beihilfe von Bund und Kanton leisteten die Waldeigentümer auf fast 2000 Hektar Schutzwald Unterhalt, was einer Investition von über 25 Millionen Franken entspricht. Mehrere Projekte für Biodiversität im Wald wurden in die Tat umgesetzt, darunter ein neues Waldreservat von 314 Hektar im Vallon de Chalin (Val d'Illiez).
Die Auswirkungen der Klimaerwärmung auf die Wälder im Kanton sind ein schwerwiegendes Thema, denn es geht hierbei um den Fortbestand der Waldfunktionen, die es trotz der sich rasch ändernden natürlichen Bedingungen und des zu hohen Wilddrucks im Ober- und Unterwallis zu erhalten gilt.
Die Unwetter im Jahr 2024 verursachten erhebliche Schäden an den Waldstrassen.
Neben der Bewältigung von Unwettern verwendet die Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft (DWNL) einen grossen Teil ihrer Ressourcen auf die verschiedenen laufenden Planungsprozesse (Mobilität, Raumentwicklung, Energie, Sportgrossanlässe usw.).
Ein Höhepunkt des Jahres war, dass das Projekt für den Regionalen Naturpark Trient-Tal in einer Abstimmung von einer grossen Mehrheit der Bevölkerung der sieben beteiligten Gemeinden angenommen wurde. Diese breite Akzeptanz ist das Ergebnis eines Prozesses, den die DWNL während sechs Jahren begleitete.
Die Realisierung der ökologischen Infrastruktur erfolgte konkret durch die Einrichtung kleiner Stillgewässer, die Unterstützung von Projekten zur Rückumwandlung brachliegender Rebbauparzellen und die Hilfestellung für Agglomerationen bei landschaftlichen Aufwertungsmassnahmen. Unterstützung (u.a. von Zivildienstleistenden und Asylsuchenden) erhielten auch die Landwirte, von denen immer mehr (derzeit 560) einen Vertrag mit der DWNL schliessen. Ihre Leistungen zugunsten von Natur und Landschaft erstrecken sich auf eine Fläche von über 3500 Hektar.
Der Druck invasiver gebietsfremder Tiere (Tigermücke und Tapinoma magnum-Ameise) hat zugenommen, was den künftigen Umgang mit ihnen erschweren und zunehmende Unannehmlichkeiten für die Bevölkerung bedeuten dürfte. Zur Bekämpfung invasiver gebietsfremder Pflanzen wurde der Einsatz von Eingreifgruppen zur Unterstützung der lokalen Partner, darunter die Gemeinden, zufriedenstellend getestet.

Integrales Wassermanagement
Im Rahmen der seit 2014 entwickelten kantonalen Wasserstrategie berief der Kanton am 1. April 2024 seinen ersten Delegierten für Wasserfragen ins Amt. Seine Aufgabe ist es, die Umsetzung der 39 kantonalen Massnahmen im Bereich Wasser zu fördern und Synergien zwischen den Gemeinden, den verschiedenen Akteuren der Wasserwirtschaft und den kantonalen Dienststellen zu aktivieren.
Der gesicherte Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle und der optimierte Verbrauch in den angespanntesten Zeiten werden als Ziele immer wichtiger.
Während sich der Kanton über Jahrzehnte auf Wasser im Überfluss verlassen konnte, gerät der Zugang zum Wasser und dessen Qualität im Wallis zunehmend unter den Druck des Bevölkerungswachstums (fast 100'000 zusätzliche Einwohner seit dem Jahr 2000), des Zustroms von Ferien- und Wochenendtouristen, neuer Industrien und sehr heisser Sommer. Darüber hinaus war der Sommer 2024 von extremen Regenperioden geprägt, die in Teilen des Kantons grossen Schaden anrichteten.
Vor diesem Hintergrund sehen die Gemeinden und die Wasserversorger Chancen in der gegenseitigen Hilfe und Zusammenarbeit. Dabei geht es darum, für versiegende Wasserfassungen und Quellen Ersatz zu finden und bei Verschmutzung oder Erdrutschen die Netzredundanz zu gewährleisten, oder auch darum, das Wasser für die Landwirtschaft, den Tourismus oder die Biotope in der benötigten Menge zu erhalten.
Lokal mögen die Gemeinden den perfekten Überblick haben, doch jetzt geht es darum, eine ganzheitlichere Übersicht über die Einzugsgebiete und letztlich über das ganze Kantonsgebiet zu erhalten. So wurden im Herbst 2024 zwei Workshops durchgeführt, an denen über zweihundert Gemeindepräsidenten, Gemeinderäte, Brunnenmeister und Wasserversorger teilnahmen. Diese erlaubten es, mögliche Synergien zwischen Gebieten und Gemeinden sowie deren tatsächliche Bedürfnisse zu erkennen. Dieser erste Schritt wird zudem jenen Gemeinden die Arbeit erleichtern, die ihre Wassernetze widerstandsfähiger machen wollen.



